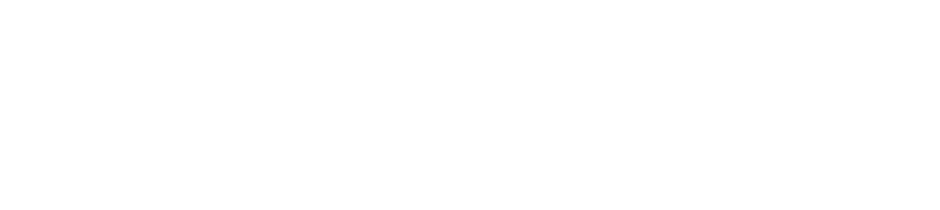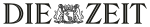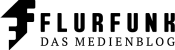"Ich erlebe eine Leichtfertigkeit, die ich nicht gut ertragen kann"
Wenige deutsche Städte sind von der zweiten Welle so betroffen wie Zittau. Oberbürgermeister Thomas Zenker spricht über düstere Monate und seine Wut auf Corona-Leugner.
Interview: Christian Bangel
Thomas Zenker (45) ist ein klassischer ostdeutscher Rückkehrer. Er verließ seine Geburtsstadt Zittau nach dem Zivildienst, um in Leipzig, Berlin und Paris zu studieren. 2009 kehrte er zurück, 2015 wurde er zum Oberbürgermeister gewählt. Zenker kämpft für mehr grenzübergreifende Zusammenarbeit und er positionierte sich früh gegen die Pegida-Proteste. In der Corona-Krise ist er ein Befürworter strenger Schutzmaßnahmen. In seiner Stadt, die von der Pandemie schwer betroffen ist, gibt es aber auch eine starke Corona-Leugner-Bewegung. Wir erreichen Zenker via Zoom in seinem Amtszimmer.
ZEIT ONLINE: Herr Zenker, wie geht es Ihnen?
Thomas Zenker: Es ist ambivalent. Wir haben hier schwere Zeiten hinter und auch noch vor uns. Aber persönlich habe ich das sehr große Glück, dass ich keinen nahen Menschen an Covid-19 verloren habe. Und auch, dass ich niemanden aus meinem Freundeskreis und Privatleben im Streit verloren habe, weil er unter die sogenannten Corona-Skeptiker gegangen ist.
ZEIT ONLINE: Ihre Stadt Zittau liegt in einer der am schwersten von der zweiten Welle betroffenen deutschen Regionen. Sie wussten vor Weihnachten nicht mehr, wo Sie die Särge noch unterbringen sollten, weil das Krematorium überlastet war. Haben Sie ein Gefühl dafür, wer die Menschen sind, die sterben?
Zenker: Wir haben sehr viele verloren, die 80 und älter waren. Man muss da fast schon von einer Generation sprechen. 80 ist heutzutage unter normalen Umständen noch kein Alter, in dem man gehen muss. Gerade habe ich für zwei absolut engagierte und aktive Menschen unserer Stadt Nachrufe veröffentlichen müssen. Deswegen werde ich auch wütend, wenn manche sagen: Was soll die Aufregung, die wären ja sowieso gestorben.
ZEIT ONLINE: Sie sprechen von der AfD?
Zenker: Nein, das kann man nicht auf AfD-Anhänger reduzieren, diese verächtliche Aussage kommt auch von so einigen anderen. Ärgerlich ist auch, dass manche behaupten, man müsse einfach nur die Alten abschirmen und könne dann für alle anderen lockern. Wir sind eine sehr alte Region, die Besuchsverbote in Pflegeheimen sind hart umkämpft und viele unserer Älteren leben bei ihrer Familie oder in häuslicher Betreuung. Man wird sie nicht schützen können, ohne die Inzidenzwerte deutlich zu senken.
ZEIT ONLINE: Haben Sie das Gefühl, dass die Bevölkerung bei den Schutzmaßnahmen mitgeht?
Zenker: Die meisten Menschen tun es. Auf der anderen Seite erlebe ich immer noch eine Leichtfertigkeit, die ich nicht verstehen und auch nicht gut ertragen kann. Manchmal erkennen mich Menschen auf der Straße und ziehen dann ein bisschen belustigt oder pflichtbewusst die Maske übers Gesicht.
ZEIT ONLINE: Es wurde in den letzten Monaten viel über die Frage diskutiert, ob die massiven Corona-Ausbrüche im Osten mit den AfD-Wählerstimmen zusammenhängen. Oder ob es, Gegenthese, die Grenzlage ist. In Zittau gibt es beides: viele AfD-Wähler und das Dreiländereck mit Tschechien und Polen. Wo sehen Sie die Ursache?
Zenker: Wer so etwas zu ergründen versucht, sollte es jedenfalls nicht in Talkshows tun. Das muss wissenschaftlich untersucht werden. Es ist in meinen Augen gefährlich zu sagen: Das sind die AfD-Wähler. Jedenfalls, solange man es nicht belegen kann. Bei uns kommt ja noch ein dritter Faktor bei den schweren Erkrankungen hinzu, nämlich die überdurchschnittlich alte Bevölkerung. Das alles sollte man mit höchstmöglicher Seriosität auswerten.
ZEIT ONLINE: Erinnern Sie sich noch, wie die zweite Welle in Zittau ausbrach?
Zenker: Wir hatten einen total unbeschwerten Sommer. Es waren überdurchschnittlich viele Touristen in der Stadt, das Wetter war perfekt. Es war sehr besonders und es war wunderschön. Mitte Oktober gab es den ersten schwerwiegenden Fall in einem Pflegeheim. Der Patient kam ins Krankenhaus, überlebte glücklicherweise auch, aber es war klar, dass sich das Virus schon verbreitet hatte. Und es dauerte tatsächlich nur drei Tage, bis wir in zwei Heimen die volle Lage hatten. Und dann ging es sehr, sehr schnell.
ZEIT ONLINE: Es gibt ein schreckliches Bild von damals. Es muss um die Weihnachtszeit geschossen worden sein. Ein Leichenwagen mit hell erleuchtetem Inneren fährt auf das dunkle Gelände des Krankenhauses. Kennen Sie das Bild?
Zenker: Ja, natürlich. Es gibt eine Formulierung aus einem Interview, die ganz gut dazu passt. Sie stammt von Dorotty Szalma, der Intendantin unseres Gerhart-Hauptmann-Theaters. Sie sprach vom "Verstummen in einer grauen Stadt".
ZEIT ONLINE: Wie war es in diesen Tagen?
Zenker: Ich tue mich leichter, es am Unterschied zum ersten Lockdown zu beschreiben. Damals, im Frühjahr, pflegten viele in der Stadt ihr soziales Netz. Es gab Videochallenges, Onlinemusikaufführungen, Fotowettbewerbe. Die Gastronomie in der Stadt, die Außerhausverkauf ermöglichte, konnte sich vor Aufträgen kaum retten. Ich weiß nicht, wie oft ich angerufen habe, um für die Familie etwas zu essen zu bestellen – und es hieß schon abends um sieben Uhr: "Nee, tut mir leid. Ausverkauft." Das war so eine Zeit, in der sich alle zusammenrissen und versuchten, da gemeinsam durchzukommen.
ZEIT ONLINE: So oder ähnlich erinnern sich wohl viele an den ersten Lockdown.
Zenker: Und gleichzeitig war in dieser Zeit bei uns ja kaum was los. Wir hatten so niedrige Infektionszahlen, dass es noch Einzelfallberichte in der Lokalpresse gab. In unseren Partnerregionen, im Schwarzwald zum Beispiel, war die Hölle los. Unsere italienische Partnerstadt Pistoia hatte im Frühjahr das Krankenhaus geschlossen, weil es nicht mehr aufnahmefähig war. Das heißt, wir hatten eine Art Secondhand-Erfahrung mit der Krise, aber keine direkte. Als dann der Herbst kam, hat es denen, die sich im Frühjahr um positiven Zusammenhalt bemüht hatten, erst einmal die Sprache verschlagen.
ZEIT ONLINE: Warum?
Zenker: Der Konflikt zwischen jenen, die Corona ernst nehmen, und denen, die das nicht tun, hatte sich über den Sommer verstetigt. Im Frühjahr haben wir ihn wahrscheinlich nicht ausgetragen, weil es so wenige Fälle gab und weil so viele mitgezogen haben. Nun wurde er existenziell. Die Auseinandersetzungen mit den Corona-Leugnern in unserer Stadt, auch dieses ganze Thema der Corona-Leugner-Demos hier an der B 96 – das steckt sehr vielen Menschen tief in den Knochen, die ganze Region wurde ja damit identifiziert. Es gibt eine Menge vernünftiger Menschen, die beschlossen haben: Ich sage da kein Wort dazu, sonst zerbricht mir mein ganzer Freundeskreis. Andere sind zermürbt von immer denselben fruchtlosen Diskussionen. Das hat tiefe Gräben hinterlassen und das macht es heute vielen schwer, sich solidarisch mit allen Mitmenschen zu fühlen.
ZEIT ONLINE: Geht es Ihnen auch so?
Zenker: Ich kann verstehen, dass man auf bestimmte Debatten keine Lust mehr hat, ja. Haben Sie schon mal von der Zwei-Wege-Quarantäne gehört?
ZEIT ONLINE: Nein.
Zenker: Wenn in einem Krankenhaus oder Pflegeheim ein Virus auftritt – das kann auch nur das Norovirus sein –, kann für Pflegerinnen und Pfleger die Zwei-Wege-Quarantäne ausgesprochen werden. Sie dürfen dann nur noch arbeiten und danach nach Hause gehen. Und wieder arbeiten und wieder nach Hause gehen. Nicht einkaufen, nicht Eis essen, nicht nix. Schlafen und wieder arbeiten. Wahnsinn, oder? So läuft das, wenn es sein muss, in den Heimen und im Krankenhaus. Ich glaube, viele Menschen, die gerade von Diktatur rumbrüllen, wissen das gar nicht. Die haben keine Vorstellung, was diejenigen mitmachen und erdulden, die uns gerade den Arsch retten.
ZEIT ONLINE: Muss man diesen Leuten als OB nicht auch mal die Meinung sagen?
Zenker: Ich habe kein Problem damit, aktiv zu kommunizieren. Im Gegenteil, manche nervt das eher. Das ist in mancher Hinsicht vergleichbar mit der Zeit nach meinem Amtsantritt, 2015, zur Pegida-Blütezeit. Damals sollten 600 Geflüchtete in die Stadt kommen. Ich hab dann einen Gastbeitrag in einer Zeitung verfasst, in dem ich sinngemäß schrieb, dass eine Stadt, die seit 1990 über 19.000 Menschen verloren hat, kein Problem damit haben kann, 600 Leute aufzunehmen. Der Gegenwind war mir damals egal, den hab ich einkalkuliert.
ZEIT ONLINE: Und heute haben Sie dafür keine Kraft mehr?
Zenker: Nein, so ist es nicht. Aber ich merke, dass es bei manchen Leuten eigentlich nichts mehr bringt, sondern nur noch ermüdet. Bei uns ist 2020 fast ein Drittel mehr Menschen gestorben als durchschnittlich in den vorhergehenden Jahren, und dieses Drittel verteilt sich fast ausschließlich auf die Monate Oktober, November, Dezember. Und der Januar ist fast genauso schlimm. Und trotzdem stellen jetzt Wortführer der Zittauer Leugnerszene statistische Berechnungen an, um zu erklären, woher diese Toten denn angeblich wirklich kommen, weil die erfassten Corona-Zahlen die Sterberate nicht abdecken. Ich habe kein Bedürfnis mehr, mich mit solchen Leuten auseinanderzusetzen. Wer alle, die heute Verantwortung tragen, mit den Nationalsozialisten oder Stalinisten vergleicht oder sein eigenes Verhalten mit Galileo oder Luther, der ist ja gar nicht mehr bereit, überhaupt irgendetwas zu akzeptieren. Der hat sich auf eine Ebene begeben, wo ein Austausch von Argumenten nicht mehr möglich ist.
ZEIT ONLINE: Was ist Ihre Antwort darauf?
Zenker: Ich ringe gerade sehr mit mir, wie ich damit umgehen soll. Und das geht nicht nur mir so, sondern auch vielen Amtskollegen, quer über alle Parteigrenzen hinweg. Also natürlich: über fast alle.
ZEIT ONLINE: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) geht mit Corona-Leugnern noch immer ins Gespräch.
Zenker: Sie spielen auf den Tag an, als er vor seinem Haus von denen besucht wurde. Mir war regelrecht schlecht vor Wut, als ich davon erfahren habe. Ich kenne ihn ganz gut und weiß, dass er noch kleinere Kinder hat als ich. Die waren an dem Tag auch da. Das war eine Grenzüberschreitung, die in meinen Augen nicht ernst genug genommen wurde.
ZEIT ONLINE: Ist Kretschmers Strategie falsch?
Zenker: Ich finde nicht, dass er mit allen und immer sprechen sollte. Aber er ist halt so, wie er ist, und man muss ihm in einer Sache ganz deutlich auch fürsprechen: Er bleibt seiner Linie treu.
ZEIT ONLINE: Nehmen Sie sich ein Beispiel an ihm?
Zenker: Ich spreche viel mit Menschen. Die meisten kommen mit konkreten Themen, brauchen vielleicht Unterstützung oder müssen auch mal nur Frust ablassen. Wer aber pauschalisiert oder mich dazu bringen will, gegen meine Überzeugungen zu handeln, kommt bei mir nicht durch. Aber vor einigen Tagen war ich – auf Kretschmers Einladung – mal wieder Teilnehmer eines Versuchs, in einem öffentlichen Format auch mit Corona-Leugnern ins Gespräch zu kommen.
ZEIT ONLINE: Und wie war das?
Zenker: Ganz ehrlich: Es ging so. Es plätscherte an der Oberfläche dahin, wurde mehr Informationsgespräch als Meinungsaustausch. Sobald es in eine Form kommt, die den Gepflogenheiten entspricht, die Höflichkeit erfordert, die moderiert ist, wo man mit Namen und Gesicht und Adresse dastehen muss und nicht als Pulk, zivilisiert sich das sofort. Es ist bemerkenswert.
ZEIT ONLINE: Besonders im Osten könnte nach Corona eine gewaltige Pleitewelle losbrechen.
Zenker: Ja, das wird uns noch sehr beschäftigen. Hier sind keine großen Sicherheiten und Rücklagen entstanden in den 30 Jahren seit der Wende. Teilweise zahlen Menschen noch heute die teuren Kredite ab, die sie in den Neunzigern für ihre Häuser aufgenommen haben. Und jetzt erleben die, dass möglicherweise alles zusammenbricht, ohne dass sie sich irgendwas haben zuschulden kommen lassen.
ZEIT ONLINE: Was erwarten Sie für die Zukunft?
Zenker: Wir müssen uns berappeln. Der Strukturwandel soll losgehen, aber bisher schlägt in unserer Region vor allem der demografische Wandel voll durch. Es ist wichtiger denn je, hinter gemeinsamen Zielen möglichst viele wieder zusammenzubringen. Mir ist klar, dass man in Angst und Not nicht immer rational reagiert. Das berechtigt aber niemanden, noch Schwächere dafür verantwortlich zu machen. Aber das ist kein Phänomen, das uns allein stellt gegenüber anderen. Leider.
ZEIT ONLINE: Sie sind im Jahr 2015 auch als glühender Europabefürworter gewählt worden. Glauben Sie, dass die Zeit der offenen Grenzen jetzt vorbeigeht?
Zenker: Das ist eine der schwierigsten Fragen überhaupt. Im Sommer stand Michael Kretschmer mit dem Landeshauptmann aus dem tschechischen Liberec auf unserem höchsten Berg, der Lausche, und sie verkündeten feierlich, dass die Grenze nie wieder derart geschlossen sein wird. Das könnten wir uns nicht leisten, das müssten wir verhindern. Und wir alle klatschten Beifall und freuten uns.
ZEIT ONLINE: Und heute sind die Grenzen de facto wieder geschlossen.
Zenker: Mir ist sehr viel bewusster geworden, dass wir bei aller Europaeuphorie hier natürlich abhängig sind von dem, was in den Regierungszentralen geschieht. Wir haben es hier mit einer immer radikaleren AfD in der Opposition zu tun, aber auch aus Warschau und Prag haben wir Populismus in der Regierung erlebt. In unserer – leider erfolglosen – gemeinsamen Bewerbung um den Titel der Kulturhauptstadt Europas 2025 haben wir auch gesagt: Freunde, wenn ihr wollt, dass Europa funktioniert, dann gebt uns diesen Titel. Wir zeigen euch genau, was nicht funktioniert, was besser werden muss. Das hat sich dieses Jahr nur noch mehr bewahrheitet. Manchmal haben wir in unserem schönen Dreiländereck schon fast vergessen, dass es auch im geeinten Europa immer noch beinahe abgeschottete nationale Systeme gibt, Gesundheit und Soziales etwa.
ZEIT ONLINE: Sie haben ein bisschen was von Ihrem Enthusiasmus eingebüßt?
Zenker: Nee, gar nicht, nur gelernt, dass Enthusiasmus auch Kraft und neue Motivation braucht. Wir haben schließlich immer noch viel zu tun. Ja, und irgendwann bräuchte ich auch mal wieder eine frische Kraftquelle, das gebe ich zu.
(Dreht sich zum Fenster in seinem Rücken um.)
Haben Sie die Geräuschkulisse bemerkt? Da unten auf dem Markt demonstrieren die sogenannten Freunde von Pegida. Zum Glück nur noch 15 Hanseln.