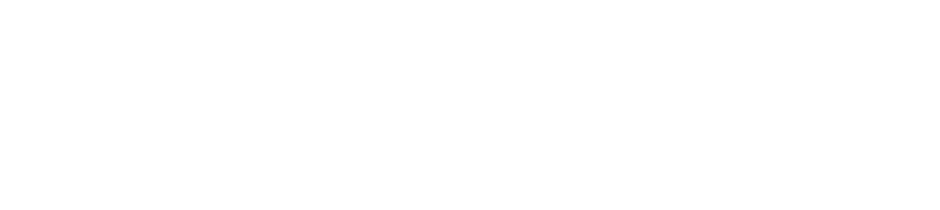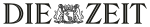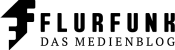Zum Internationalen Kindertag
Kindheit in der DDR: Die distanzierte Generation
Von Ron Schlesinger
Er wurde in der DDR groß gefeiert: der Internationale Tag des Kindes. Doch wie sah Jungsein abseits des 1. Juni in den 1970er- und 1980er-Jahren aus? Ein Blick zurück.
"Kommt Thomas am 1. Juni um 9 Uhr mit zur Festwiese?", fragt die Lehrerin im Muttiheft eines Erstklässlers Ende der 1970er-Jahre. "Ja", antwortet Mama oder Papa mit Unterschrift in dem postkartengroßen Mitteilungsbuch, das in der DDR für Notizen ans Elternhaus dient.
Was ist das auch für eine Frage? Schließlich ist am 1. Juni der Internationale Tag des Kindes. Das Datum ist seit 1950 ein großes Ereignis für alle Kinder zwischen Kap Arkona und Fichtelberg. Denn es ist ihr Tag. Und das Beste: Für alle DDR-Schüler ist der 1. Juni obendrein unterrichtsfrei.
Am Morgen geht es auf den Schulhof oder die Festwiese. Hier sind Spiel- und Bastelstände aufgebaut. Oder Mitmach-Stationen wie Sackhüpfen oder Eierlaufen, wo jeder Süßigkeiten und kleine Geschenke gewinnen kann. Und manchmal gibts sogar einen Klassenausflug in die nächstgrößere Bezirksstadt. Ach, wenn nur immer Kindertag wäre.
Fröhlich sein und singen am Kindertag
Aber, war der 1. Juni nicht auch der Tag, an dem die Schulklassen militärisch durchorganisiert in Reih und Glied aufmarschiert sind? Auf Knopfdruck fröhlich sein und singen mussten? Und das auch noch mit dieser weißen Pionierbluse und einem – ständig am Hals kratzenden – blauen oder roten Halstuch?
Egal, ob es um Erinnerungen, speziell an den 1. Juni oder generell an die Kindheit im ehemaligen Osten geht: Jeder hat hier seine ganz eigenen Kindheitsbilder im Kopf. Persönliche Erfahrungen, sprich: ein erinnertes Leben, das mit dem oftmals Gehörten manchmal nur wenig gemeinsam hat.
Denn die Kindheit in der DDR gab es nicht. Vielmehr gibt es viele individuelle Geschichten über das Jungsein in einem vor über 30 Jahren untergegangenen Land.
"Ein verzerrt adaptierter Kollektivismus"
Dass diese ostdeutschen Kindheitsbilder aber Linien, Rituale oder Ereignisse prägen, wie der alljährliche Kindertag am 1. Juni, mag dennoch keiner bestreiten.
Das beginnt schon im frühen Kindesalter. So kommen Babys oft ab der sechsten Lebenswoche in die bereits 1949 eingeführten Krippen. Im Laufe der knapp 40-jährigen DDR-Geschichte werden diese Betreuungsangebote konsequent ausgebaut. Mit Erfolg: Bekommt Mitte der 1950er-Jahre gerade mal jedes zehnte Kind einen Krippenplatz, so sind es in den 1980er-Jahren bereits acht von zehn.
Dabei soll die Kinderkrippe wie auch der Kindergarten, in den die Steppkes ab dem dritten Lebensjahr gehen, schon von Beginn auf eine künftige Integration in die Gesellschaft vorbereiten. Diese Erziehung basiert laut der Entwicklungspsychologin Lieselotte Ahnert auf dem "Konzept eines verzerrt adaptierten Kollektivismus", was übersetzt heißt: Individuelles Verhalten ist okay, solange es sich in gruppenorientierte Vorstellungen einpasst.
Am falschen Tag geboren zu sein
Dagegen ist den meisten ein anderes Ereignis vielleicht noch gut im Gedächtnis: die Einschulung. Vielleicht aber auch nicht, weil sie das Pech – oder das Glück – hatten, am falschen Tag geboren zu sein. Warum?
In der DDR gibt es damals eine Stichtagsregelung: Kinder, die bis zum 31. Mai sechs Jahre alt sind, dürfen im September desselben Jahres eingeschult werden. Erreichen sie erst danach das sechste Lebensjahr, müssen sie bis zum darauffolgenden Herbst warten.
Doch egal, ob man mit sechs oder sieben eingeschult wird, der Zuckertütenbaum wird auch in der Polytechnischen Oberschule (POS) der DDR in der Schulaula gepflückt. Im Osten sollen die Tüten oft sechseckig und mit rund 85 Zentimeter sogar etwas größer gewesen sein als die West-Pendants. Die gab es aber ohnehin nicht zu kaufen.
Wer nicht mitzieht, wird schief angeguckt
Wenige Wochen nach der Einschulung werden die meisten Kinder Pioniere, oder genauer gesagt: Sie treten in die bereits 1948 gegründete Pionierorganisation "Ernst Thälmann" ein. Weniger freiwillig, mehr aus Gruppenzwang. Wer nicht mitzieht, wird schief angeguckt, oft ausgegrenzt.
Ihr Namensgeber Ernst Thälmann, geboren 1886, war einst KPD-Führer und wurde 1944 von den Nazis im KZ Buchenwald ermordet. In der DDR wird "Teddy" als heldenmütiger Kämpfer zur Ikone stilisiert – aber auch politisch instrumentalisiert und ziemlich verklärt.
Jeder Jungpionier erhält bei seiner feierlichen Aufnahme – meist am 13. Dezember, dem Pioniergeburtstag – eine eigene Mitgliedskarte, in der auch zehn Gebote abgedruckt sind.
"Wir Jungpioniere lieben unsere Eltern"
Die klingen so ähnlich wie die zehn Gebote in der Bibel. Nur mit dem Unterschied, dass es jetzt statt "Du sollst Vater und Mutter ehren" oder "Du sollst nicht stehlen" etwas abgewandelt heißt: "Wir Jungpioniere lieben unsere Eltern" oder "Wir Jungpioniere lernen fleißig, sind ordentlich und diszipliniert."
Später treten an die Stelle der Jungpionier-Gebote die Gesetze der Thälmannpioniere, zu denen die Kinder in der vierten Klasse wechseln.
Im Rückblick fragt man sich, ob die DDR, die vor allem der jungen Generation die Religion austreiben wollte, sich nicht auch nur ein paar griffiger Regeln bediente, um die Haltung des – hier sozialistischen – Menschen zu seinen Mitmenschen abzustecken.
"Bunte Pionierveranstaltung"
Sechs- oder siebenjährige Jungpioniere in der 1. Klasse interessieren sich damals aber mehr für die gemeinsamen Pioniernachmittage, die mal mehr, mal weniger ideologisch rot eingefärbt sind. Und auch immer ein wenig vom "sozialistischen Standpunkt" oder der "Überzeugung" des jeweiligen Klassenlehrers abhängen.
Da kann es passieren, dass sich hinter einer – vordergründig politischen – "Bunten Pionierveranstaltung" einfach ein eher unpolitischer Kinobesuch verbirgt. Und man für 25 Pfennige Eintrittsgeld bei "Der Geschichte vom kleinen Muck" mitfiebert, dem mit knapp 13 Millionen Zuschauern erfolgreichsten DDR-Kinofilm.
Die Partei der Kleinen
Dass es auch die andere Seite, den Drill, die Uniformität, den Anpassungsdruck gibt, weiß jeder, der seine Kindheit im Osten verbringt. Wilfried Poßner, der von 1985 bis 1989 Vorsitzender der Pionierorganisation ist, sagt rückblickend und durchaus kritisch, dass die "Organisation im Laufe der Zeit immer enger in die Strukturen der SED eingebunden wurde, bis hin zu bestimmten Ritualen und Zeremonien, und im Grunde genommen, die Partei der Kleinen sein sollte."
Zu diesen Regeln zählen vor allem Begrüßungsrituale ("Für Frieden und Sozialismus. Seid bereit!" – "Immer bereit!") und Fahnenappelle. Hier marschieren die Schüler im Klassenverband auf dem Schulhof im Gleichschritt und schmettern sinnentleerte Kampflieder, wie dieses:
Pioniere, voran lasst uns vorwärts gehn! Pioniere, stimmt an, lasst die Fahnen wehn!
Unsre Straße, sie führt in das Morgenlicht hinein. Wir sind stolz, Pioniere zu sein!
Wir sind stolz, Wiener Würstchen zu sein!
Doch nicht alle DDR-Kinder, die etwa zwischen 1961 und 1975 geboren sind, haben Bock auf diese Rotlichtbestrahlung. Sie wachsen zwar behütet im Sozialismus auf, doch nehmen sie die Widersprüche und Probleme des Systems viel früher wahr als Generationen vor ihnen.
Mitunter zeigt sich diese Opposition im Kleinen, in Details, in Nuancen – die Kinder machen sich anfangs ein wenig lustig über ihre Heimat DDR und texten so manches Kampflied einfach um (wenn auch hinter vorgehaltener Hand):
Unsre Straße, sie führt in den Suppentopf hinein. Wir sind stolz, Wiener Würstchen zu sein!
"Distanzierte Generation"
Der Soziologe Bernd Lindner spricht hier von der sogenannten "distanzierten Generation". Jene jungen Menschen verbringen ihre Kindheit in den 1970er- und 1980er-Jahren, werden aber immer weniger in ihrem Alltag erreicht. Die Loyalität gegenüber ihrem Geburtsland schwindet allmählich.
Der Medienwissenschaftler Dieter Wiedemann schreibt, dass die Mehrheit der DDR-Bevölkerung damals zudem aus ihrem System emigriert – und zwar allabendlich medial. In einer seinerzeit unveröffentlichten Studie des Zentralinstituts für Jugendforschung (ZIJ) aus dem Jahr 1985 werden etwa 1.300 Leipziger Schüler und Schülerinnen (also 9- bis 10-Jährige) nach ihren Lieblingssendungen im Fernsehen befragt. Das Ergebnis überrascht nicht.
Donnerlippchen, Simon & Simon, Na sowas!
21 Prozent der Nennungen betreffen Unterhaltungssendungen wie "Die verflixte 7" (ARD), "Wetten, dass ..." (ZDF) und "Donnerlippchen" (ARD). 22 Prozent entfallen auf Kindersendungen wie "Spaß am Dienstag" (ARD), "Na sowas!" (ZDF), "Alles Trick" (DDR I). Und 28 Prozent auf Serien wie "Simon & Simon" (ARD), "Neumanns Geschichten" (DDR I) und "Tom und Jerry" (ZDF).
Mitte der 1980er-Jahre schauen ältere Kinder also mehrheitlich Westfernsehen. Jene "distanzierte Generation" ist mit dem Klassenfeind bestens vertraut und rückt immer ein Stück weiter vom sozialistischen Projekt ab. Gleichzeitig versuchen die DDR-Oberen dagegenzuhalten, den Kindern etwas zu bieten. In der Schule sind das zum Beispiel die Arbeitsgemeinschaften, kurz: AGs.
Pelmeni essen und Tee aus Samowar trinken
Sie werden von Lehrern geleitet, sind aber für die Schüler freiwillig. Von der "Mathematik"-AG, über "Junge Brandschutzhelfer" oder "Junge Fotografen" bis zur AG "Russisch" – in der russische Teigtaschen (Pelmeni) gegessen und Tee aus einem echten Samowar getrunken wird.
Zudem subventioniert und organisiert der Staat zahlreiche Kinderferienlager, bei denen sich viele heute noch an Nachtwanderung und Neptunfest oder erster Kuss und Abschied erinnern.
"Schreibst du mir, wenn du zu Hause bist?" – Ja, klar. Was ist das auch für eine Frage? Schließlich ist die Liebe wie der 1. Juni etwas ganz Besonderes.